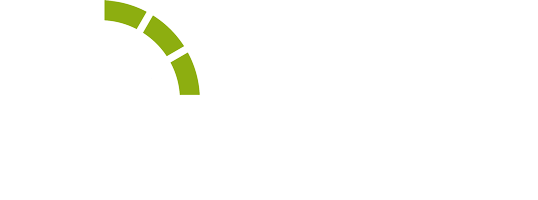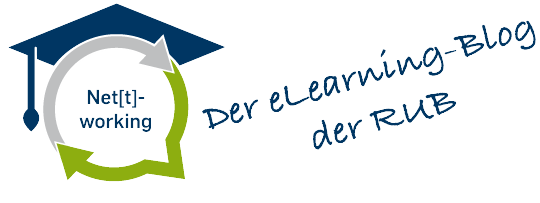Die Hochschuldigital-Verordnung (HDVO), die dieses Jahr in NRW in Kraft getreten ist, regelt, inwieweit digitale Lehre ohne Präsenz und rein digitale (Online-)Prüfungen zulässig sind. Ab einem bestimmten Maß dürfen Lehrende nicht selbst entscheiden, ob sie ihre Vorlesung als Zoom-Konferenz oder ihre Veranstaltung rein asynchron anbieten. Gleiches gilt für reine Online-Prüfungen. Die Begründung dafür, dass Lehrveranstaltungen mit höheren Anteilen an Online-Lehre nicht einfach so durchgeführt werden dürfen, ist, dass als Teil der akademischen Bildung nicht nur die Vermittlung von Fachkenntnissen aufgefasst wird, sondern auch die Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden. Für dieses Ziel ist soziale Interaktion in Präsenz notwendig. Außerdem soll damit die Chancengleichheit der Studierenden berücksichtigt werden. Digitale Lehre und digitale Prüfungen
Was ist mit digitaler Lehre/digitalen Prüfungen gem. HDVO gemeint?
In der HDVO werden digitale Lehre und digitale Prüfungen speziell definiert. Diese Definitionen decken sich nicht mit dem Alltagsverständnis und umfassen nur eine bestimmte Auswahl von dem, was im landläufigen Sinne unter digitaler Lehre und digitalen Prüfungen verstanden wird.
Was ist mit digitaler Lehre/digitalen Prüfungen gem. HDVO gemeint?
Unter digitaler Lehre im Sinne der HDVO wird Lehre verstanden, die vollkommen ohne Präsenzanteile stattfindet, so wie es während der Coronazeit praktiziert worden ist. Gleiches gilt für digitale Prüfungen. Damit sind digitale Klausuren und mündliche oder praktische Prüfungen in digitaler Form gemeint, die die Prüflinge nicht an der Universität ablegen. Bei Lehrveranstaltungen kann es sich dabei um Veranstaltungen in Zoom handeln, aber auch um Online-Kurse, die asynchron bearbeitet werden. Nach der Pandemie sind diese Art von Veranstaltungen seltener geworden. In der Regel gibt es nun wieder, wie vor der Coronazeit, Präsenzveranstaltungen mit begleitenden Moodlekursen. Diese werden meist ergänzend zur Präsenz angeboten. Mit dieser Form der digitalen Lehre beschäftigt sich jedoch die HDVO nicht. Bei Prüfungen handelt es sich um beaufsichtigte digitale Klausuren sowie mündliche oder praktische Prüfungen, die per Videokonferenz durchgeführt werden. Auch hier sind digitale Klausuren, die vor Ort beispielsweise in einem E-Prüfungsraum geschrieben werden, nicht gemeint.
Digitale Lehre: Mehr oder weniger als 25 %?
Die Digitalverordnung regelt ausschließlich digitale Lehre ohne Präsenzanteile. Erst wenn bei Lehrveranstaltungen der Anteil an reiner digitaler Lehre von 25 % überschritten ist, wird von digitaler Lehre gesprochen. Digitale Lehre in diesem Sinne kann aus synchronen Elementen, in der Regel Webkonferenzen, und/oder asynchronen Elementen (z. B. digitalen Aufgaben) bestehen. Am besten lässt sich dies an Beispielen erklären:
Eine Lehrveranstaltung soll im Rahmen einer Kooperation mit ausländischen Universitäten als reine Online-Veranstaltung mit synchronen und asynchronen Elementen angeboten werden, so dass auch Studierende aus dem Ausland teilnehmen können. In diesem Fall umfasst der Zeitanteil der Digitallehre mehr als 25 % und es handelt sich daher dabei um Digitallehre im Sinne des Gesetzes. In einem solchen Fall muss der Fachbereichsrat mit Zustimmung des Studienbeirats entscheiden, ob die Veranstaltung durchgeführt werden darf. Die Entscheidung kann bezogen auf einzelne Lehrveranstaltungen getroffen werden oder aus einem Digitallehrkonzept der Fakultät heraus.
Ein anderes Beispiel könnte sein, dass eine Lehrveranstaltung anstelle von Präsenz ein Drittel aller Termine als asynchrones Selbststudium anbietet. Während dieser Phase findet keine Präsenzlehre statt. In der restlichen Zeit gibt es reguläre Präsenztermine. Auch diese Form der Digitallehre muss die Zustimmung des Fachbereichs- oder Studienbeirats finden, weil der Anteil der Digitallehre mehr als 25 % beträgt.
Es gibt viele Gründe, rein digitale Lehrveranstaltungen anzubieten. Insbesondere Lehre mit internationalem Bezug ist dafür geeignet oder Lehrkonzepte, die von längeren asynchronen Lernphasen profitieren. Aber auch aufgrund von Care-Verpflichtungen, Krankheit oder Behinderung kann digitale Lehre in Frage kommen. Die quantitative Grenze liegt immer bei 25 %, ab welcher Lehrende nicht mehr selbst entscheiden können und es eine Zustimmung von genannten Gremien benötigt.
Liegt der Anteil digitaler Lehre im Sinne der HDVO unter 25 %, entscheiden Lehrende selbst, inwieweit sie synchrone oder asynchrone Elemente losgelöst von Präsenz nutzen wollen. Beispielsweise könnten problemlos einzelne Termine per Zoom durchgeführt werden, solange es nicht mehr als ein Viertel aller Termine in einem Semester sind. Auch eine asynchrone Phase, die anstelle von max. 25 % aller Veranstaltungstermine tritt, ist möglich.
Das Gros der im herkömmlichen Sinne verstandenen digitalen Lehre ist jedoch nicht von der HDVO betroffen. Begleitende Moodlekurse zu Präsenzveranstaltungen, die beispielsweise auch ein Selbststudium vorsehen, sind ohne Auflagen möglich.
Auch hybride Veranstaltungen im Sinne einer Übertragung oder Aufzeichnung einer Veranstaltung fallen nicht unter Digitallehre, da diese Veranstaltungen immer auch einen Präsenzanteil haben. Gleiches gilt für Formate, die als Inverted Classroom durchgeführt werden. Denn im Inverted Classroom Modell ist Präsenz unverzichtbar.
Blended Learning bezeichnet eine Mischung aus Präsenz- und Online-Lehre. Wird die Online-Lehre immer nur begleitend zur Präsenzlehre angeboten, greift die HDVO nicht. Wenn Blended-Learning-Modelle mit längeren reinen Online-Phasen umgesetzt werden, deren Zeitanteil mehr als 25 % beträgt, ist eine solche Veranstaltung genehmigungspflichtig.
Für die meisten digital gestützten Veranstaltungen entstehen durch die HDVO keine Änderungen. Gerät eine Lehrveranstaltung aber, ohne dass dies im Digitallehrkonzept vorgesehen ist, in die Reichweite digitaler Lehre, kann das Konsequenzen für Prüfungen haben.
Ist eine Veranstaltung mit einem Anteil von mehr als 25% digitaler Lehre durchgeführt worden und ist dies nicht mit dem Fachbereichs- und Studienbeirat abgestimmt worden, können Prüflinge innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses gegenüber der Hochschule zu erklären, dass die Prüfung als nicht unternommen gilt.
Die HDVO regelt außerdem digitale Prüfungen. Damit sind reine Online-Prüfungen gemeint, z. B. überwachte Online-Klausuren oder Open Book-Klausuren, aber auch mündliche oder praktische Prüfungen per Videokonferenz. Hier entscheidet analog zur digitalen Lehre der Fachbereichsrat und Studienbeirat, ob diese möglich sind oder es gibt eine entsprechende Regelung in der Prüfungsordnung. Bei digitalen Klausuren ist außerdem eine Videoaufsicht erforderlich, d. h. es muss die Kamera- und Mikrofonfunktion aktiviert werden.
Wie wird die HDVO an der RUB umgesetzt?
An der RUB hat das Rektorat sich in Abstimmung mit der Universitätskommission für Lehre (UKL) und den Studiendekan*innen für die Umsetzung der HDVO in Form von Digitallehrkonzepten und gegen Detailregelungen in Prüfungsordnungen oder Modulhandbüchern entschieden.
Derzeit erarbeiten alle Fakultäten der RUB ihre Digitallehrkonzepte. Digitale Prüfungen werden zudem in einer Rahmenordnung geregelt. Die HDVO sieht ein Monitoring vor, d. h. die Fakultäten legen dem Rektorat jährlich einen Bericht vor, aus dem hervorgeht, inwieweit die Vorgaben der Digitallehrkonzepte eingehalten worden sind.
Angeklickt & weitergelesen