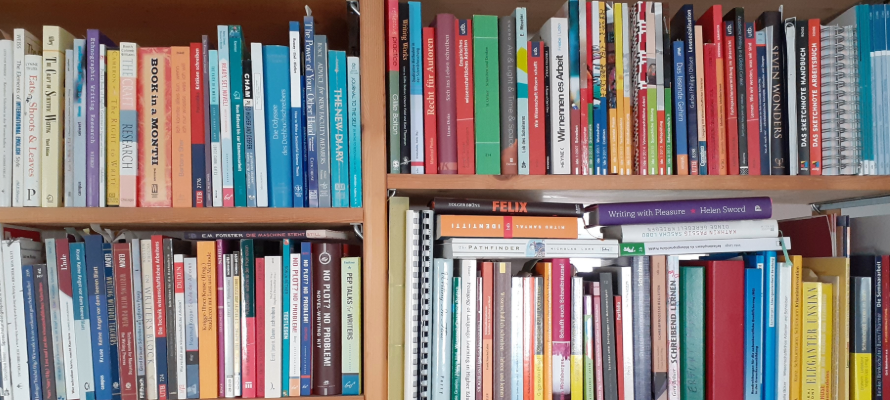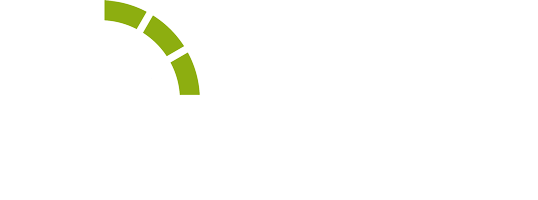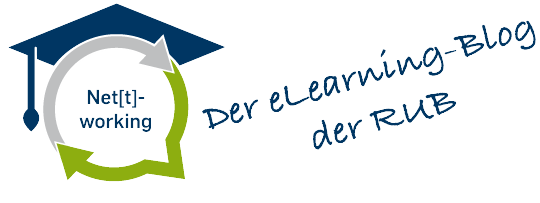Das Verfassen von Texten beinhaltet immer auch eine Selbstprüfung: Meine ich wirklich, was ich schreibe, und schreibe ich auch tatsächlich, was ich meine? Wie gehe ich sicher, dass die Aussage meines Textes für Dritte nachvollziehbar ist? In diesem Beitrag stellt Ihnen Dr. Janelle Pötzsch, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Schreibzentrums, einen womöglich etwas ungewöhnlichen Text vor, der Ihnen bei der Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen helfen kann.
Seit nunmehr zweieinhalb Jahren arbeite ich bereits in der Schreibdidaktik des ZfW. Als
Schreibberaterin in den Ingenieurwissenschaften unterstütze ich Studierende in ihrem Schreibprozess sowie bei der Aneignung grundlegender Fertigkeiten des wissenschaftlichen Schreibens im Rahmen von Workshops und Seminaren.
Als Philosophin hatte ich sowohl während meines Studiums als auch in meiner Arbeit immer einen Bezug zum Schreiben. Doch bei meinem Einstieg in die Schreibdidaktik erging es mir ein bisschen wie dem Charakter aus Molières „Der Bürger als Edelmann“, dem plötzlich aufging, dass er sein ganzes Leben lang Prosa gesprochen hatte: Rückblickend scheinen mir unzählige Texte aus meinem Studium wie auch meiner Arbeit auf Thesen und Erkenntnisse der Schreibdidaktik zu verweisen!
Einen dieser Texte möchte ich Ihnen in diesem Blogbeitrag vorstellen: George Orwells Essay
„Politics and the English Language“ (1946). Diesen habe ich im Rahmen meines Seminars „Philosophie der Dystopie“ behandelt, welches ich im Sommersemester 2021 an der Universität Paderborn gegeben habe. In dieser Veranstaltung sollte zum einen das Konzept der Dystopie als solcher untersucht und zum anderen der philosophische Gehalt von Werken wie Margaret Atwoods
Handmaid’s Tale, Ray Bradburys
Fahrenheit 451 und George Orwells
Nineteen Eighty-Four herausgearbeitet werden. Wir beschäftigten uns mit Fragen u.a. nach den politischen und ideologischen Strukturen der jeweiligen dystopischen Gesellschaften, welchen gesellschaftlichen Idealen sie jeweils entgegengesetzt werden, unter welchen Umständen es den Protagonisten möglich ist aufzubegehren, welche Rolle die Sprache in ihnen spielt und wie sie das Verhältnis zwischen den Geschlechtern gestalten.
Ergänzend zu den o.g. Romanen haben wir im Seminar nicht nur ausgewählte Sekundärliteratur gelesen, sondern auch den erwähnten Essay von George Orwell. Diesen habe ich für die Sitzung zu „Sprache und Literatur“ angesetzt.
Orwell ist berühmt für seinen klaren Stil, und in seinem Essay prangert er die sprachliche Nachlässigkeit an, wie sie uns etwa in politischen Reden, aber auch in wissenschaftlichen Abhandlungen oder Leitartikeln begegnet. Für Orwell ist die nachlässige Verwendung von Sprache, etwa in der Form von überstrapazierten Metaphern, ein Zeichen von Denkfaulheit:
„By using stale metaphors, similes and idioms, you save much mental effort at the cost of leaving your meaning vague, not only for your reader but for yourself“
(ORWELL, S. 128)
Orwell sieht Sprache und Denken in einer Wechselbeziehung (dies ist übrigens ein wichtiger Gedanke der Schreibdidaktik!):
“[L]anguage […] becomes ugly and inaccurate because our thoughts are foolish, but the slovenliness of our language makes it easier for us to have foolish thoughts“
(ORWELL, S. 127)
Ursprünglich habe ich Orwells Essay gewählt, um in meinem oben genannten Seminar eine zusätzliche Diskussionsgrundlage für das Neusprech aus Nineteen Eighty-Four zu haben – jener stark vereinfachten Sprache, die es Bürgern unmöglich machen soll, einen der Partei unliebsamen Gedanken zu fassen. Doch Orwells Text machte mich auf Probleme aufmerksam, wie sie auch beim Schreiben an der Uni auftauchen und die sowohl Lehrende als auch Studierende in ihrer Rolle als Schreibende beschäftigen.
Da wäre zunächst die Rolle des Schreibens für das Denken. In seinem Klassiker der englischen Stilistik On Writing Well (1976) bezeichnet William Zinsser Schreiben als „thinking on paper“, Denken auf Papier (Zinsser 1976: 147). Schreiben ist ein Mittel, Gedanken zu entwickeln. Die Herausforderung besteht darin, diese zu formulieren! Achten Sie mal darauf: Wetten, dass Probleme beim Schreiben immer dann auftauchen, wenn Ihnen unklar ist, worüber Sie eigentlich schreiben möchten bzw. worauf genau Sie mit Ihrem Text hinauswollen?
Ungeübte (oder auch: nachlässige) Autor*innen greifen in solchen Situationen häufig auf leichtgängige, abgegriffene Ausdrücke zurück, die ihnen die mentale Arbeit des Nachdenkens und präzisen Formulierens ersparen. Anstatt prägnant zu formulieren, begnügen sie sich damit, sowohl vor ihren eigenen Augen als auch denen ihrer Leser*innen zwar bekannte, jedoch ungenaue Bilder hervorzurufen, die anschließend nach Belieben mit Bedeutung gefüllt werden können. So verliert der eigene Text jedoch an Aussagekraft. (Test: Wann ist etwas „innovativ“? Worin unterscheidet sich eine „Zielsetzung“ von einem „Ziel“? Wie weit reicht ein „Quantensprung“?).
Der bequeme Rückgriff auf schablonenhafte Phrasen und Plastikwörter birgt eine weitere Gefahr für Autor*innen: Wer sich ihrer bedient, hindert sich daran, eine eigene „Schreib-Stimme“ zu entwickeln. Erst durch sie klingt ein Text „nach uns“. Wer sich hinter Formulierungen versteckt, wird wenig authentische, „fremd“ klingende Texte produzieren. Vor allem aber haben Autor*innen das, was sie schreiben, zu verantworten und dies ist kaum möglich, wenn leere Phrasen verwendet werden. Ein solches Verstecken resultiert oft aus nicht ausreichender Schreibpraxis. Unerfahrene Autor*innen greifen gerne auf Wendungen und Ausdrücke zurück, wie sie uns allzu oft in digitalen und Printmedien, dem Marketing, in Podcasts oder im Fernsehen begegnen: sie scheinen griffig, sind jedoch in erster Linie abgegriffen. Erst beim genauen Lesen wird deutlich, dass sie unklar, ungenau oder schlichtweg falsch sind.
Dieser (tunlichst zu vermeidende) Gebrauch inhaltsleerer Redewendungen und Ausdrücke ist jedoch nicht mit der
Verwendung wissenschaftssprachlicher Formulierungen zu verwechseln. Gerade in wissenschaftlichen Texten ist es nötig und wünschenswert, bestimmte, mitunter auf den ersten Blick formelhaft wirkende Ausdrücke und Fachbegriffe zu verwenden. Mit ihnen gliedern wir unsere Texte und führen unsere Leser*innen durch unsere Argumentation. Nur so lässt sich in der Wissenschaft eindeutig und genau kommunizieren und den Weg der Wissensproduktion nachzeichnen. Doch selbst innerhalb der verschiedenen, stark formalisierten Fachsprachen könnte Orwell zufolge zugänglich und vor allem eindeutig geschrieben werden. (Dies als Hinweis an all jene, die glauben, wissenschaftliche Texte müssten wahnsinnig kompliziert und sperrig geschrieben sein, um als solche anerkannt zu werden…).
Mich fasziniert an Orwells Essay vor allem seine Kombination aus Bodenständigkeit und hohem Anspruch an sich selbst sowie seine These, dass sich intellektueller Anspruch eben nicht notwendigerweise in komplizierter Ausdrucksweise zeigt, sondern ganz im Gegenteil der klare Ausdruck anspruchsvoller Gedanken eine hohe intellektuelle Leistung ist. Orwell verdeutlicht anhand zahlreicher Beispiele, dass Schreiben Arbeit ist – nicht mehr und nicht weniger. Damit zeigt er gleichzeitig auf, dass Schreiben auch eine ethische Dimension hat: Um einen guten, d.h. inhaltlich aussagekräftigen und sprachlich prägnanten Text zu verfassen, müssen wir uns und anderen gegenüber ehrlich sein. Diese Ehrlichkeit erfordert viel Arbeit; wir müssen uns darüber klar sein, worauf wir in unserem Text hinauswollen, und dabei gleichzeitig immer auch unsere potentiellen Leser*innen vor Augen haben, damit wir intersubjektiv nachvollziehbare Texte zu Papier bringen. Deshalb, so Orwell, ist es so wichtig, eine klare, eindeutige Sprache zu verwenden und auf hohle Phrasen oder betont abstrakte Ausdrücke zu verzichten.
Orwell schließt seinen Essay mit sechs Regeln, die er seinen Leser*innen empfiehlt:
"(i) Never use a metaphor, simile or other figure of speech which you are used to seeing in print.
(ii) Never use a long word where a short one will do.
(iii) If it is possible to cut a word out, always cut it out.
(iv) Never use the passive where you can use the active.
(v) Never use a foreign phrase, a scientific word or a jargon word if you can think of an everyday English equivalent. [dies gilt natürlich nicht für wissenschaftliche Texte, J.P.]
(vi) Break any of these rules sooner than say anything barbarous" (Orwell, S. 139)
Doch genau genommen hat Orwell keinen Stilratgeber verfasst, sondern einen Appell: Sein Essay thematisiert die politische Dimension ungenauer Sprachverwendung. Denn vor allem in der Politik dient die Sprache nicht ausschließlich der Verständigung, sondern kann auch wenig rühmliche Motive verhüllen:
„Political language – and with variations this is true of all political parties, from Conservatists to Anarchists – is designed to make lies sound truthful and murder respectable“
(ORWELL, S. 139)
Genaue, ehrliche Sprache erfordert genaues, ehrliches Denken und umgekehrt. Einen kritischen Blick auf unsere wie auch auf fremde Text zu entwickeln, ist daher nicht nur eine Frage des guten Stils. Dass Orwell die politischen Aspekte unseres Sprachgebrauchs so prägnant und eindringlich schildert, macht diesen Essay für mich so faszinierend.
Molière (1993). Der Bürger als Edelmann. Le Bourgeois gentilhomme. Leipzig: Reclam.
Orwell, George (1969). „Politics and the English Language.“ In: Ders., The collected essays, journalism and letters of George Orwell. Bd. 4: In front of your nose: 1945-1950. London: Sekcher & Warburg (S. 127-139).
Zinsser, William (1976). On Writing Well. New York: Harper Perennial.
So unterstützen wir Sie dabei, Ihre Formulierungsfähigkeit weiterzuentwickeln:
Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie im Sinne Orwells klar und verständlich formuliert haben, fragen Sie andere, wie sie Ihren Text verstanden haben. Sie können auch einen Termin zur Schreibberatung vereinbaren und einen exemplarischen Textausschnitt mit uns besprechen.
Titelbild: Ulrike Lange