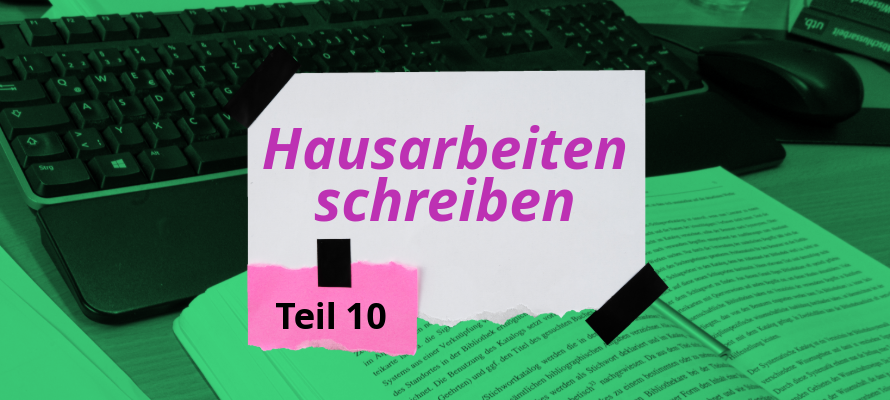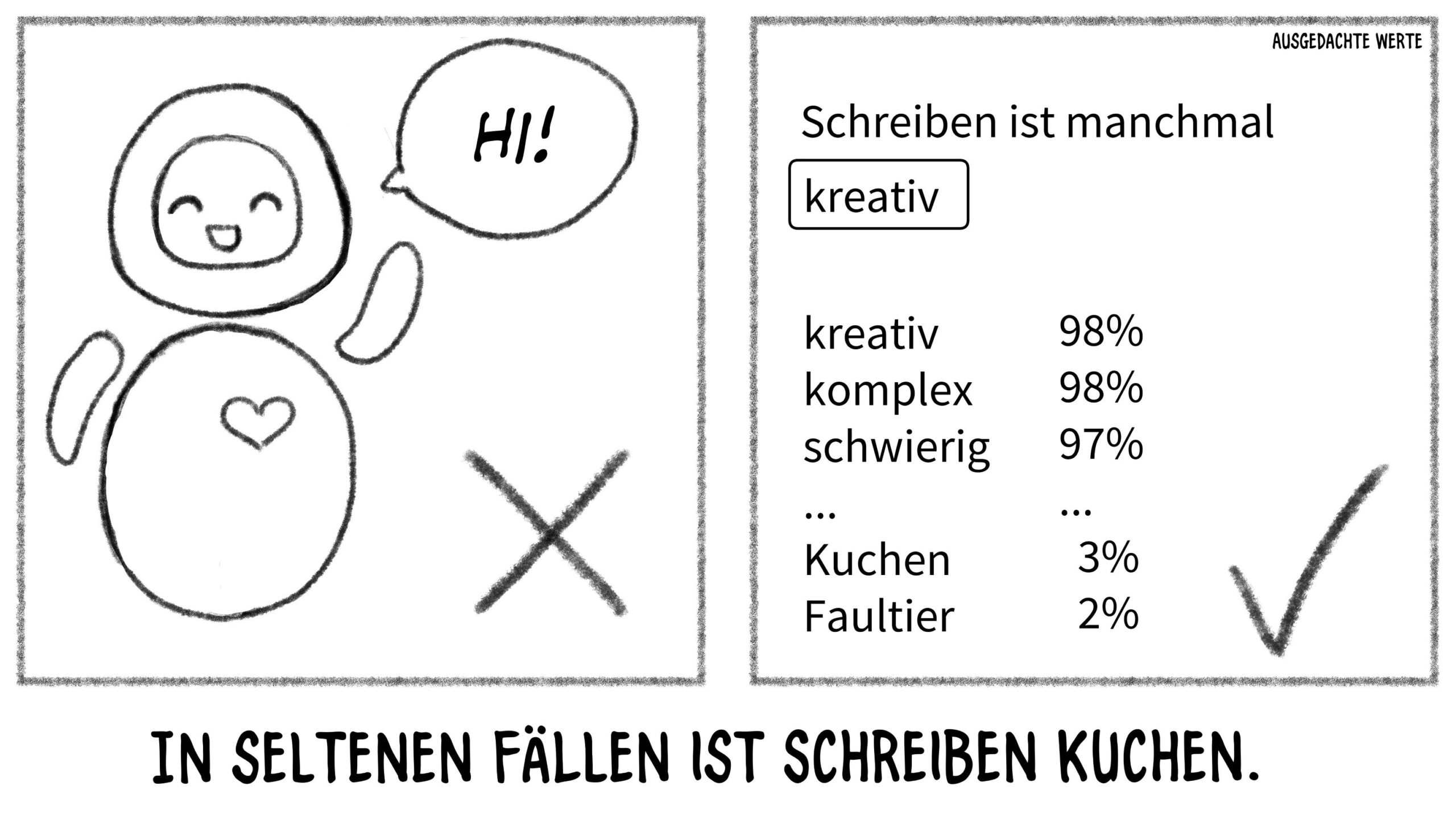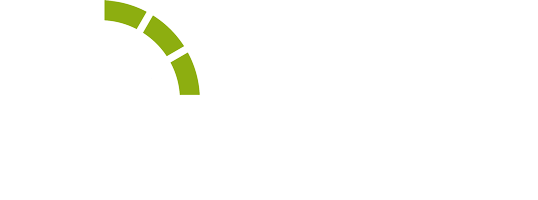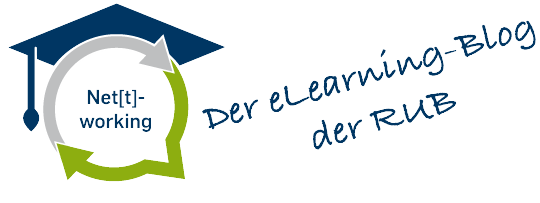Alle, die viel schreiben bzw. schreiben müssen, kennen es: Du starrst auf den Bildschirm und es fällt dir einfach nichts ein, du löscht immer wieder den Satz, den du gerade geschrieben hast, oder du tust alles, um ja nicht schreiben zu müssen. Dass das Schreiben schwerfällt, es nur sehr stockend vorwärts geht oder auch mal gar nicht funktioniert, ist sehr normal. Hier finden Sie einige Anregungen, damit umzugehen.
Worum es in dieser Serie geht
Diese Serie richtet sich an Studierende, die eine Hausarbeit schreiben (wollen). In loser Folge werden wir – die
Mitarbeiter*innen des Schreibzentrums – verschiedene Aufgaben erläutern, die beim Schreiben einer Hausarbeit auf Sie zukommen, und Ihnen Anregungen dazu geben, wie Sie sie konkret bewältigen können. Wir werden uns dabei bemühen deutlich zu machen, was fachübergreifend gilt und was fachspezifisch ist. Sie sollten dennoch prüfen (oder jemanden fragen), ob das, was wir hier sagen, auch so auf Ihr Fach zutrifft.
Eine kleine Einschränkung: „KI“?
Zu Beginn eine Einschränkung: Der Begriff „KI“ („Künstliche Intelligenz“) ist missverständlich und kann sich auf ganz unterschiedliche Anwendungen und Methoden beziehen, die auf ebenso unterschiedliche Weise den Schreibprozess beeinflussen können – z. B. Recherchealgorithmen, wie sie in Suchmaschinen und Datenbanken stecken, Analysemethoden, mit denen man wissenschaftliche Daten auswerten kann, oder auch Anwendungen zur automatisierten Übersetzung. Im Folgenden geht es ganz spezifisch um sogenannte generative LLMs (Large Language Models), die häufig auch über ein Chatbot-Interface verfügen – also beispielsweise ChatGPT, Gemini, Claude usw. Wenn Sie interessiert, wie diese LLMs funktionieren, können Sie sich
dieses Video anschauen.
Schreiben mit generativen LLMs – ja oder nein?
Viele Menschen haben ganz unterschiedliche Haltungen zum Schreiben mit „KI“ (also: generativen LLMs). Das kann verwirrend sein und verunsichern. Zum Beispiel hört man oft von dem Vorwurf, Studierende würden sich mit generativen LLMs die Arbeit erleichtern oder sie zum Täuschen nutzen. Umgekehrt wird manchmal sogar gefordert, unbedingt „KI“ in den Schreibprozess zu integrieren, weil das der Arbeitsweise der Zukunft entspräche und man ansonsten „hinterherhinken“ könnte. Sie sehen sich also vielleicht mit unterschiedlichen Erwartungen konfrontiert, die manchmal ganz explizit, manchmal aber auch nur implizit kommuniziert werden. Ob und wie Sie ein LLM nutzen möchten, ist aber am Ende eine Entscheidung, die Sie selbst treffen können, obwohl diese Entscheidung natürlich von einigen Rahmenbedingungen abhängt.
Rechtlicher Rahmen: Verbote, Eigenständigkeit & Transparenz
Da wären zum Beispiel rechtlich relevante Aspekte. An der RUB sind Anwendungen mit LLMs nicht grundsätzlich verboten. Die Nutzung kann aber im Rahmen von Prüfungen eingeschränkt oder mit einer Kennzeichnungspflicht verbunden sein. Das müssen die Prüfenden rechtzeitig bekanntgeben, z. B. zusammen mit den Formalia für Hausarbeiten. Da auch Lehrende oft unsicher sind, was die Nutzung von LLMs angeht, kann es helfen, in einen offenen Austausch zu gehen und die Lehrenden dazu aufzufordern, die Regeln für die konkrete Veranstaltung zu klären.
Grundsätzlich gilt: Sie unterschreiben bei einer schriftlichen Prüfung wie einer Hausarbeit eine Eigenständigkeitserklärung. Ihre Leistung muss also eigenständig erbracht worden sein. Was das genau heißt, ist aber vielleicht nicht immer leicht zu entscheiden. Hilfreich kann es sein, wenn Sie sich überlegen, wie Sie es handhaben würden, wenn Sie eine*n Mitstudierende*n um das Gleiche gebeten hätten wie ein LLM. Korrekturlesen würde man da anders bewerten, als wenn Sie sich Textteile vorgeben lassen, die Sie einfach kopieren. Näheres dazu können Sie in
diesem Rechtsgutachten nachlesen (insb. S. 32–33).
Auf der sicheren Seite sind Sie, wenn Sie mit der*dem Prüfer*in besprechen, wofür Sie ein LLM nutzen dürfen und wie Sie das gut angeben können.
Auch abgesehen vom Rechtlichen: In der Wissenschaft ist Transparenz ein wichtiger Wert – es sollte immer nachvollziehbar sein, wie eine Erkenntnis zustande gekommen ist, denn das macht sie nachvollziehbar und auch kritisierbar(!). Dass wir in der Wissenschaft unser Wissen immer wieder auf den Prüfstand stellen und auch anderen die Möglichkeit geben, unsere Ergebnisse infrage zu stellen, sorgt dafür, dass wissenschaftliches Wissen verlässlich ist. Deshalb sollte auch die Nutzung generativer LLMs gekennzeichnet sein, wenn sie zum Erkenntnisprozess beigetragen hat.

Generative LLMs
sollen Denkprozesse übernehmen. Das ist die Idee, mit der sie von Unternehmen wie OpenAI entwickelt werden. Auch wenn immer wieder argumentiert wird, dass es sich „nur“ um Werkzeuge handle, ist es wichtig, sich diese langfristigen Ziele, die die Entwicklung der Technologie leiten, vor Augen zu führen. Man kann mit LLMs auf eine Weise arbeiten, in der man selbst zum Denken angeregt wird, aber das ist nicht die naheliegende und intuitive Nutzungsweise – weil diese Modelle eben für einen anderen Zweck designt werden: Denkprozesse zu übernehmen/abzunehmen. Deshalb sollten Sie immer gut überlegen, an welchen Stellen Sie Denkprozesse auslagern, die sonst beim eigenen Schreiben oder Lesen in Gang gesetzt würden und von denen Sie selbst profitieren würden.
Das berührt auch die Frage des Lernens. Es gibt verschiedene Studien, die in die eine und in die andere Richtung argumentieren: LLMs können beim Lernen hilfreich sein oder aber es ganz verhindern. Das hängt natürlich auch mit der Art der Nutzung und der zugrundeliegenden Motivation zusammen. Grundsätzlich gilt das Gleiche, was für Lernen immer gilt: Was Sie selbst machen, üben Sie; was Sie an andere abgeben (sei es ein LLM oder eine andere Person), daraus lernen Sie wahrscheinlich wenig. Gerade das wissenschaftliche Schreiben kann im Studium eine große Herausforderung sein und vielleicht ist es verlockend, Dinge, von denen Sie glauben, dass Sie sie selbst nicht gut können, an ein LLM abzugeben – und vielleicht führt es auch hin und wieder tatsächlich zu besseren Ergebnissen. Aber nur an Herausforderungen können Sie auch wachsen und Neues dazulernen.
Wägen Sie also immer ab: Wenn ich hier auf ein LLM zurückgreife, nehme ich mir da vielleicht die Chance, etwas Wichtiges zu üben? (Und die Antwort kann sowohl „Ja“ als auch „Nein“ lauten, aber es ist wichtig, das immer wieder zu reflektieren!)
„Man lernt immer etwas – die Frage ist nur, was.“ Diesen Satz habe ich von einem Erziehungswissenschaftler und finde ihn passend für die folgende Übung:
Machen Sie mal einen direkten Vergleich. Versuchen Sie z. B., eine Aussage aus einem Forschungstext zunächst selbst zu paraphrasieren, dann mithilfe eines LLM. Welche Beobachtungen machen Sie dabei? Was fällt Ihnen leicht, was schwer? Welche Unterschiede bemerken Sie? Was, denken Sie, haben Sie jeweils gelernt – beim „Selbstmachen“ und beim Nutzen des LLM?
Schließlich gibt es noch ethische Aspekte, die eine Rolle spielen können. Prinzipien der Eigenständigkeit und der guten wissenschaftlichen Praxis habe ich weiter oben schon thematisiert. Nachhaltigkeit ist ebenfalls ein Thema, das auch bezüglich LLMs diskutiert wird, auch, wenn nicht sicher ist, wie schädlich für die Umwelt sie letztendlich sind (eine Einordnung finden Sie
hier ). Die Praktiken, mit denen Unternehmen wie OpenAI, Anthropic, Meta usw. die LLMs trainiert haben, sind ebenfalls ethisch bedenklich (z. B. die prekäre Situation der Data Worker*innen, die dafür sorgen, dass die Modelle „sicher“ sind; oder auch die Übernahme von vielen Werken menschlicher Autor*innen und Künstler*innen, die weder um ihre Zustimmung gebeten noch kompensiert wurden). Hier ist es gut, wenn Sie Ihre eigenen Werte reflektieren und abwägen, was Ihnen wichtig ist – und das durchaus situations- und kontextspezifisch. Dieselbe Antwort ist nicht immer richtig – aber es ist ein wichtiger Schritt für die verantwortungsvolle Nutzung, dass Sie reflektiert an diese Entscheidung herangehen.
Tipps zur Nutzung von LLMs?
Viele wünschen sich Tipps zur „guten“ Nutzung von Anwendungen wie ChatGPT, Gemini & Co., z. B. zum sogenannten „Prompting“ – das meint die Eingaben, die man beim Nutzen des LLMs macht. Es ist aber so, dass diese Tools extra so gebaut sind, dass sie sich besonders intuitiv bedienen lassen – auch das gehört zur Idee dieser Modelle und steckt in ihrem Design.
Es gibt also kein verstecktes „Geheimwissen“, mit dem Sie der „KI“ die besten Ergebnisse entlocken können.
Diese Tatsache kann entlastend sein, aber sie bedeutet auch, dass etwas anderes zählt: Nämlich das eigene Wissen und die Expertise, die man in dem Bereich hat, für den man ein LLM nutzt. Da durch LLMs durchaus falsche oder nicht hilfreicher Output generiert werden kann, müssen Sie in der Lage sein, das zu überprüfen. Das gilt für das Erkennen falscher Informationen, aber auch darüber hinaus. Wenn Sie ein LLM z. B. zum Lernen nutzen wollen, hilft es nicht viel weiter zu wissen, wie man promptet, sondern Sie brauchen Wissen über hilfreiche Lernstrategien – dann können Sie auch relativ leicht einen guten Prompt formulieren. Als Faustregel könnte man sagen:
Um ein LLM gut zu nutzen, benötige ich Fachkenntnis; und wenn ich Fachkenntnis habe, ist es recht einfach, ein LLM gut zu nutzen.
Einige Hinweise zur Nutzung gibt es trotzdem: LLMs sind Wahrscheinlichkeitsverteilungen, d. h., sie geben an, mit welcher Wahrscheinlichkeit Wörter zusammen mit anderen Wörtern in bestimmten Kontexten auftreten. Das hat verschiedene Konsequenzen:
Sie können dem Output nur bedingt vertrauen, weil sich falsche Informationen einschleichen können.
Der Output kann Verzerrungen (Bias) enthalten – z. B. stereotypisierende Aussagen.
LLM-Chatbots sind „Ja-Sager“ – der Output spiegelt das, was man hineingibt.
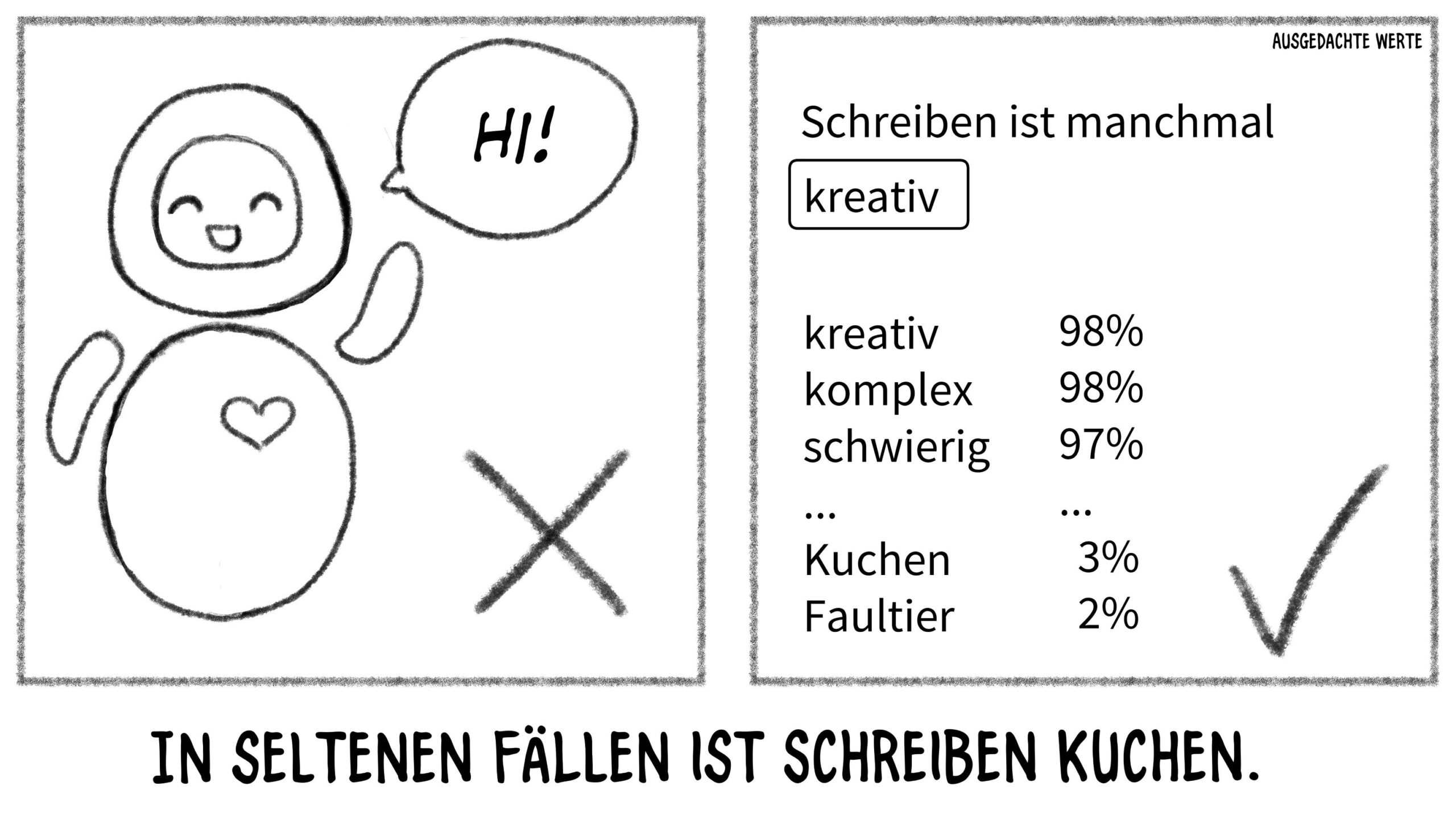
Immer wieder hört man, dass „KI“ dafür sorgen werde, dass sich Schreibpraktiken und auch das wissenschaftliche Arbeiten verändern. Das kann gut sein. Ich selbst als Schreibende in einer Gemeinschaft vieler anderer Schreibender wünsche mir, dass wir selbst darüber entscheiden können, wie wir in Zukunft schreiben wollen; mit und ohne LLMs. Dass es Zwänge gibt – Zeitdruck, Wettbewerb, vielleicht manchmal auch die Bequemlichkeit – die es nahelegen, ein LLM zu nutzen, sehe ich und ich kann es gut nachvollziehen, wenn jemand die Vorteile, die LLMs mit sich bringen, nutzen möchte. Ich reibe mich aber einer zynischen, zum Teil fatalistischen Haltung, der ich zurzeit immer wieder begegne: Dem sogenannten technologischen Determinismus, der jeden Spielraum zur Mitgestaltung, der sich bei der neuen Technologie bietet – auch hinsichtlich der Möglichkeit, sich dagegen zu entscheiden – verneint. Das sind Aussagen wie: „Die ‚KI‘ ist jetzt da und geht nicht mehr wieder weg, deshalb müssen wir …“ Aus solchen Aussagen entstehen oft weitgreifende Forderungen, die zu selbsterfüllenden Prophezeiungen werden können. Wir alle tragen einen kleinen der Teil der Verantwortung dafür, wie diese Technologie in Zukunft unseren Alltag gestalten wird, und diese Verantwortung sollten wir ernst nehmen. Nur in einem Dialog, in dem unterschiedliche Haltungen ernstgenommen werden, kann uns das gelingen. Wenn Sie sich über Ihre Nutzung generativer LLMs Gedanken machen, Ihre Entscheidung bewusst treffen und mit anderen darüber sprechen, gestalten Sie diesen Aushandlungsprozess mit.
- Wenn Sie Tipps zum Prompting suchen, schauen Sie mal in das durch OpenRUB bereitgestellte Prompt Labor.
- Eine lesenswerte Position zum Thema „technologischer Determinismus“ finden Sie hier: „Nobody Owns The Technofuture“ (englisch).
- Auch in Ratgebern zum wissenschaftlichen Schreiben finden Sie mittlerweile Einiges zum Thema „Schreiben mit KI“, beispielsweise im Ratgeber „Wissenschaftliches Schreiben mit KI“ von Isabella Buck. Auch im Buch „Fachtexte lesen – verstehen – wiedergeben (3.Auflage)“ von Ulrike Lange wird die Entscheidung, generative „KI“ beim Lesen zu nutzen, in einem eigenen Kapitel beleuchtet, das viele hilfreiche Überlegungen enthält.
- Haben Sie Fragen zu generativen LLMs? Schauen Sie in unsere FAQ und nehmen Sie bei weiteren Fragen gerne Kontakt zu uns auf.
- In unseren Workshops bekommen Sie das notwendige Wissen über wissenschaftliches Schreiben und wissenschaftliche Texte – und immer können Sie auch Fragen zum jeweiligen Thema stellen, die sich aus der Verwendung von KI ergeben.
- Bei Fragen zum Schreiben – mit und ohne KI – besuchen Sie das Schreibcafé oder machen Sie einen Termin zur Schreibberatung.
In unserer Serie "Hausarbeiten schreiben" sind schon einige Beiträge erschienen. Lesen Sie gerne rein:
Bildnachweis: Nadine Lordick