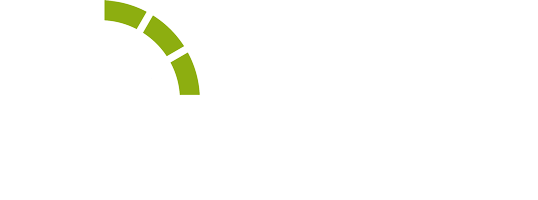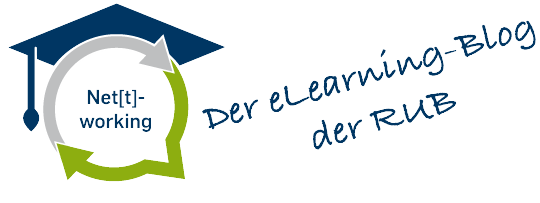Demokratie braucht Partizipation. Deshalb sind Hochschulen gefordert, alle Akteursgruppen partizipieren zu lassen – auch in der Lehre. Mit dieser These als Ausgangspunkt haben wir beim diesjährigen University Future Festival (U:FF) einen Workshop angeboten, in dem wir unterschiedliche Aspekte von Partizipation in der Lehre herausgearbeitet und in Beziehung zu Demokratie-Fragen gestellt haben. Studierende gestalten aktiv mit
Eigenverantwortung fördern
An der Hochschule ist unser gemeinsames Ziel klar: Wir möchten, dass Studierende zu selbstbestimmtem Handeln in der Lage sind, und fähig, Eigenverantwortung zu übernehmen. So steht z.B. in § 58 (1) des Landeshochschulgesetzes (LHG) NRW: „Lehre und Studium vermitteln den Studierenden“ die Studieninhalte „so, dass sie [… ] zur kritischen Einordnung wissenschaftlicher Erkenntnis und zu verantwortlichem Handeln befähigt werden“. Die Frage ist: Wie nähern wir uns diesem Ziel, zumal in einem universitären System, das auf verschiedenen Ebenen auf einer Hierarchie zwischen Studierenden und Lehrenden beruht? Eine Möglichkeit ist, Studierende in der Lehre stärker partizipieren zu lassen.
Partizipation bedeutet Mitgestaltung. Das Erleben gelungener Mitgestaltung im Kontext von Ausbildung und Arbeit stärkt – so die Hoffnung – wiederum die Wahrnehmung der eigenen Gestaltungmöglichkeiten auch in politischer Hinsicht. Umgekehrt kann eine nur vorgespielte Partizipation demotivieren, die Überzeugung stärken, sowieso keinen Einfluss zu haben und so auch das Vertrauen in (demokratische) Mitbestimmungsprozesse schwächen.
Fallstricke und Grenzen der Partizipation
Deshalb ist es in Lehr-Lern-Kontexten wichtig, den Rahmen für Partizipation genau abzustecken und nur dort zur Mitbestimmung einzuladen, wo sie auch umgesetzt werden kann. Denn offensichtlich gerät der Anspruch, Studierende ‘mit ins Boot zu holen’, in der Hochschullehre schnell an Grenzen: sei es durch feste Curricula, starre Prüfungsordnungen oder angespannte Betreuungskapazitäten. Die elementaren Spielregeln universitärer Lehre können (und sollen) durch Partizipation nicht außer Kraft gesetzt werden.
Wer Partizipation verspricht, sollte sich sicher sein, dieses Versprechen auch einhalten zu können und zu wollen.
Ein weiteres Risiko besteht darin, dass unreflektierte Partizipationsversprechen insbesondere dort zu Enttäuschung und Ernüchterung führen, wo sie Beteiligung bloß vorgaukeln oder dazu dienen, die Verantwortung für Entscheidungen abzuwälzen: So ist beispielsweise ein „Stimmungsbild“, auf dessen Grundlage die Seminarleitung eine Entscheidung trifft, noch keine demokratische Abstimmung – und sollte deshalb auch nicht als solche angepriesen werden. Stattdessen ist es sinnvoll, als Lehrperson vorab zu reflektieren, wo die Einladung zur Partizipation am Platze ist, wo andererseits die Handlungsspielräume durch externe Vorgaben zu stark eingeschränkt sind oder Lehrende aus der Verantwortung ihrer Rolle heraus Entscheidungen besser selber treffen.
(Vor-)Stufen der Partizipation
Doch ist Partizipation überhaupt eine Entweder-Oder-Angelegenheit? Entscheide ich mich als Lehrperson schlicht dafür oder dagegen, Studierende in einer Lehrveranstaltung partizipieren zu lassen? Plausibler scheint es, Partizipation graduell zu denken (Mayrberger 2019). Sie kennt Grade und Abstufungen. An den Rändern der Partizipation eröffnet sich ein ganzes Spektrum an Vorformen und Grenzphänomenen – angefangen beim punktuellen Einbeziehen oder reinen Anhören auf der einen Seite, bis hin zur Selbstorganisation oder vollen, Partizipation überschreitenden Autonomie auf der anderen Seite (Mayrberger 2019, S. 98-101). Mayrbergers Stufenmodell der Partizipation bietet hier eine gute Orientierung. Sie unterscheidet:
Typ I: Nicht-Partizipation
(Beispiele: Fremdbestimmung; im Lehrkontext etwa Vorlesungen, die keine Mitwirkung der Studierenden vorsehen)
Typ II: Vorstufen der Partizipation; Pseudo- oder Schein-Beteiligung
(Beispiele: Einbeziehung oder Anhörung; im Lehrkontext etwa Abstimmungen oder Erwartungsabfragen)
Typ III: Partizipation
(Beispiele: Mitwirkung oder Mitbestimmung in der Lehrgestaltung; etwa forschendes Lernen )
Typ IV: volle Autonomie
(Beispiele: Selbstverwaltung, selbstorganisiertes Lernen, etwa studentische Ringvorlesungen)
Für die Lehre bedeutet das zunächst: Partizipation ist anspruchsvoll! Wer sich als Studierende*r mit einem Wortbeitrag ins Seminar einbringt, macht damit nicht schon von einer Partizipationsmöglichkeit Gebrauch. Vielmehr geht insbesondere ‚echte‘ Partizipation (Typ III) weit hinaus über das Einholen studentischer Stimmen, über den Einsatz von
Voting-Tools zur Themenabfrage oder über Feedback und
Veranstaltungsevaluation – zumal dann, wenn diese folgenlos bleiben (“Scheinbeteiligung”). Sie setzt voraus, Studierenden bereits beim thematischen Zuschnitt eines Kurses umfassend Mitbestimmung zu gewähren und ihnen für alle Phasen der Lehrgestaltung – von der Wahl geeigneter Methoden bis hin zur Ergebnispräsentation – Entscheidungsmacht zu übertragen. Die Rolle Lehrender verschiebt sich damit – der Idee nach – tendenziell in Richtung lernbegleitender Coaches oder beratender Expert*innen. Und dafür wiederum braucht es sowohl die situativen Möglichkeiten als auch die individuelle Bereitschaft, Studierende bei Entscheidungen miteinzubeziehen und hierfür einen klaren Rahmen abzustecken.
Räume für Partizipation / Räume durch Partizipation
Da Menschen sich im Raum begegnen – sei es im physischen, im digitalen oder im hybriden –, hat Mitgestaltung meist eine gewisse räumliche Komponente: Räume determinieren zwar nicht, was in ihnen passiert. Sie eröffnen jedoch Handlungsoptionen oder schränken sie ein. Menschen und Räume stehen nicht selten – wie es der Architekturtheoretiker Bernard Tchumi formulierte – in einer Beziehung der Reibung oder Konflikts zueinander (Tschumi 1996). Das gilt genauso für die Lehre: Jeder Vorstoß, in einem großen Hörsaal mit Klapptischen eine Gruppendiskussion zu starten, endet regelmäßig in der halbresignierten Beobachtung, der Hörsaal sei doch ein Paradebeispiel für „Interaktionsverhinderungsarchitektur“ (Hausendorf 2020, S. 171). Partizipation impliziert nun aber in den meisten Fällen Interaktion. Räumlich unterstützen können wir sie durch
Lernraumkonzepte, die die klassische Vorn-Hinten-Unterscheidung unterlaufen: Gruppentische, bewegliche Möbel, mehrere Präsentationsflächen, kurzum: polyzentrische Lernumgebungen statt der etablierten Einbahnstraße zwischen Dozierendenpult und Reihenbestuhlung. Unterstützen können wir sie zudem, indem wir
hybrides Zusammenarbeiten infrastrukturell erleichtern – und so beispielsweise Menschen mit Beeinträchtigungen, Studierenden in den unterschiedlichsten Lebenssituationen, auch im internationalen Austausch echte Mitgestaltung ermöglichen.
„Räumlich unterstützen können wir Partizipation durch Lernraumkonzepte, die die klassische Vorn-Hinten-Unterscheidung unterlaufen.“
Und schließlich erscheinen Räume nochmals in ganz anderem Licht, wenn wir sie nicht lediglich als ‚Bühne‘ sehen, auf der Partizipation stattfindet, sondern sie selbst als formbar, offen, unfertig und damit als etwas Gestaltbares wahrnehmen. Räume – mehr als ‚Prozess‘ denn als ‚Produkt‘ begriffen – können so zum integralen Bestandteil partizipativer Lehrformate werden: Es lohnt sich, ein gemeinsam entwickeltes Lehrkonzept zu diskutieren und gemeinsam zu entscheiden, in welche räumlichen Settings einzelne Phasen gehören, welche Lernaktivitäten besser On-Campus oder Off-Campus, im Physischen oder im Digitalen, im Seminarraum oder im Freien stattfinden. Und warum nicht auch einen Lehrraum gemeinschaftlich so herrichten, dass er zu den Lernzielen einer Veranstaltung passt? In gewissen Grenzen geht das sogar an großen Universitäten mit engeren Handlungsspielräumen in der Raumgestaltung.
Im universitären Kontext stoßen wir an mehreren Stellen auf Hindernisse, wenn es um Partizipation Studierender in der Lehre geht, z.B. bei Vorgaben zur Lehre, bei Räumen, und natürlich bei Prüfungen. Da es keine Lösung ist, echte Partizipation nur in unkreditierten Lehrveranstaltungen zu etablieren, stehen Lehrende vor der Herausforderung, inwiefern sie Prüfungen partizipativ(er) gestalten können. Nein, wir können nichts daran ändern, dass es Prüfungsordnungen gibt, dass Prüfungen bestimmte Funktionen erfüllen, und dass geprüft und benotet werden muss. Das Spannungsverhältnis ist bei Prüfungen besonders groß, genauso wie das Hierarchie-Gefälle. Da hilft ein Blick auf Beispiele anderer Hochschulen, die ein Spektrum an möglichen Partizipationsformen aufzeigen.
Studierende können das Prüfungsformat aus einer vorgegebenen Auswahl selbst wählen.
So ist z.B. an der Beispiel TH Köln eine Kombination von Prüfungsformen mit einer mündlichen Gruppenprüfung (mit Note 1,7 für alle) möglich (Pataki-Hundt/ Börngen, 2024). An der TU Dresden wird das Konzept der „Prüfungstheke“ erprobt, d.h. Studierende können das Prüfungsformat aus einer vorgegebenen Auswahl selbst wählen (Albrecht et al., 2023). Außerdem finden sich in der Literatur Ideen wie die, dass Lehrende mit Studierenden die Bewertungskriterien diskutieren (Nölte, 2024), und dass sie die Lernenden in die Konzeption von Prüfungsfragen einbeziehen (Lautner, 2018).
Partizipation in der Hochschullehre kann zur Gratwanderung werden: So steht die Leitidee, ‘Sparringspartner’ auf Augenhöhe zu sein, in Spannung zur Wissensasymmetrie, wie sie für Lehrbeziehungen an Universitäten kennzeichnend ist. Das erfordert von der Lehrperson Rollenklarheit und Planung. Wer als Lehrperson Studierende bei Entscheidungen ‘mit ins Boot holt’, muss bereit sein, den Balanceakt zu leisten und transparent zu machen: Prozesse demokratischer Willensbildung können im Widerspruch stehen zu den Anforderungen festgelegter Curricula. Dazu kommen Entscheidungsprivilegien, die auf der eigenen wissenschaftlichen Expertise beruhen. Denn es ist ja genau diese Expertise, die Lehrende üblicherweise zu kritischen Interventionen befähigt, die sie dazu autorisiert, in Lehrsituationen Einspruch zu erheben, zu widersprechen, Diskussionen zu lenken oder auch zu unterbinden – kurzum: von “Praktiken des Gegenwirkens” Gebrauch zu machen (Balzer 2024, S. 175).
Für Studierende wiederum mag Partizipation bis zu einem gewissen Grad auf ‚Kollaboration‘ hinauslaufen: Sie ist Einladung zur Mitgestaltung – und das in “einem geschlossenen System […], in dem die zur Wahl stehenden Optionen und jene, die sie anbieten, nicht in Frage gestellt werden können” (Weizman 2012, S. 13). Denn getragen ist Partizipation in der Lehre von einem nicht mehr hinterfragbaren Grundkonsens über die Rahmenbedingungen von Universitätslehre selbst. Oder anders gesagt: Wer sich durch partizipative Prozesse ‘mit ins Boot holen’ lässt, darf davon ausgehen, mit denjenigen, die eingeladen haben, schlussendlich im selben Boot zu sitzen. Dass das Experiment Partizipation sich trotz aller Unsicherheiten, Beschränkungen und Fallstricke dennoch lohnen kann, zeigen Beispiele gelingender Partizipation: Sie machen evident, dass Hochschullehre eine Gemeinschaftsaufgabe von Lehrenden und Lernenden ist – eine Aufgabe, für die es sich lohnt, auch im Sinne demokratischer Mitgestaltungskompetenz gemeinsam Verantwortung zu übernehmen.
Albrecht, C., Schmidt, J., & Jantos, A. (2023). Die Prüfungstheke als Prüfungsstrategie der Zukunft. Zeitschrift für Hochschulentwicklung, 18(3), S. 213–239. https://doi.org/10.21240/zfhe/18-03/11
Balzer, Nicole, Bellmann, Johannes & Ehlers, Eva (2024): Kritik üben. Gesprächspraktiken des Gegenwirkens in der Hochschullehre. In: die hochschullehre 10 (2024), S. 174-187.
Hausendorf, Heiko (2020): Interaktion und Architektur. Was man über die Vorlesung aus dem Hörsaal lernen kann. In: Lob der Vorlesung. Vorschläge zur Verständigung über Form, Funktion und Ziele universitärer Lehre. Hg. von Rudolf Egger und Balthasar Eugster. Wiesbaden: Springer, S. 165-203.
Lautner, S. (2018). Gemeinschaftlich gestellte Klausur. In: Gerick, J./ Sommer, A./ Zimmermann, G. (Hrsg), Kompetent Prüfungen gestalten, S. 93-96. Münster: Waxmann.
Mayrberger, K. (2019). Partizipative Mediendidaktik: Gestaltung der (Hochschul-)Bildung unter den Bedingungen der Digitalisierung. Beltz Juventa.
Nölte, B. (2024). Kollaboration ermöglichen und bewerten. In: A. Langela-Bickenbach, R. Dreier, P. Wampfler & C. Albrecht (Hrsg.), Wege zu einer zeitgemäßen Prüfungskultur. Grundlagen und Praxisbeispiele. S. 60-67. Weinheim: Beltz.
Pataki-Hundt, A. & Börngen, M. (2024). Mix it! Shake it! Taste it! – Humorvolle und inspirierende Prüfungsformen mit Studierenden entwickeln. In: Neues Handbuch Hochschullehre, Ausgabe 115, H3.11, S. 61-74. Berlin: duz.
Tschumi, Bernard (1996): Architecture and Disjunction. Cambridge: MIT Press.
Weizman, Eyal (2012): Das Paradox der Kollaboration. In: Markus Miessen: Albtraum Partizipation. Berlin: Merve, S. 13-15.
Die Autor*innen dieses Artikels :

Prüfungen, LEHRELADEN, Lehrevaluation, "Wissen, was zählt"

Schreibberatung & -gruppen, Plagiatsprävention, Betreuen

Stabsstelle Strategische Lehrprojekte
Koordination des Projekts "Flächen der Zukunft: Lehr- & Lernflächen"
Weitere Infos und Anregungen rund um das Thema:
Studentische Beteiligungs- und Gestaltungmöglichkeiten in Lehrveranstaltungen sind an der RUB auch Thema des Leitbilds Lehre.
Wenn Sie mehr Partizipation in die Lehre integrieren wollen, wie beraten Sie gerne.